Das Lexikon der Liebe
Nun weiter mit der Sydney Review of Books. Viele, viele Rezensionen und Essays harren noch der Lektüre und der Verarbeitung, aber wir wählen aus, was in den manipogo-Gemischtwarenladen passt. Da hätten wir zunächst einen Auszug aus der Autobiografie von Abbas El-Zaid, Professor in Sydney. Das Buch heißt Bullet, Paper, Rock: A Memoir of Words and War. Gleich mehr!
Abbas El-Zair ist Professor für Geo-Ökologie und stammt aus dem Libanon. Er ist 1963 geboren, also sogar 6 Jahre jünger als ich. Ich lerne ja Arabisch und nahm kürzlich entsetzt zur Kenntnis, dass das Arabische einen Wortschatz von 12 Millionen Wörtern besitzt; das Deutsche mit 500.000 und das Italienische mit 450.000 sind dagegen Zwerge. El-Zair schreibt über das Arabische als Sprache der Liebe, betont in seinem Essay aber auch, dass das Arabische seit dem 11. September 2001 (der Anschlag auf die Twin Towers in New York) als Sprache des Feindes gilt. Wer Arabisch spricht, ist von vornherein verdächtig. Dabei ist es eine wunderbar poetische Sprache, da wird nicht nur geröchelt. Geben wir Abbas El-Zair das Wort:
Lexikon der Liebe
 Arabische Muttersprachler sind verwöhnt, wenn es um Ausdrücke für die Liebe geht. Wenigstens 25 arabische Wörter für verschiedene Schattierungen von Liebe, Zuneigung und liebesinduzierte Zustände sind nach meiner Zählung in Gebrauch. Die tatsächliche Zahl soll zwischen 50 und 100 betragen, wenn man formelle arabische Wörter mit einschließt, die nicht im täglichen Umgang vorkommen:
Arabische Muttersprachler sind verwöhnt, wenn es um Ausdrücke für die Liebe geht. Wenigstens 25 arabische Wörter für verschiedene Schattierungen von Liebe, Zuneigung und liebesinduzierte Zustände sind nach meiner Zählung in Gebrauch. Die tatsächliche Zahl soll zwischen 50 und 100 betragen, wenn man formelle arabische Wörter mit einschließt, die nicht im täglichen Umgang vorkommen:
hub, hawaa, gharaam, walaa. hanaan, shaghaf, kalaf, shawq, walah, tatayyum, haneen …
Keine zwei Wörter haben dieselbe Bedeutung, und das Vokabular umgreift einen Umkreis von Emotionen, Stimmungen und Beziehungen mit und um das geliebte Wesen, während es Myriaden Arten von Liebe beschreibt – sinnliche, fleischliche oder keusche, profane oder göttliche, fröhliche oder melancholische.
Von Liebe als Zärtlichkeit (atf oder sababa), Verlorenheit (wajd) oder Gefühlen von Wärme gegenüber jemandem (wod), als keusche (eeffa), ewige (rasseess) oder unerwiderte (lajaa) Liebe, reicht es bis zu Lobhudelei (oshq), Vernarrtheit (wallah) und leidenschaftlicher Liebe (hiaam). Liebe, die uns brennen lässt, ist huraaq, und Liebe, die sticht, ist lathgh. Es gibt unterdrückte Liebe (kamad), Liebe als Freude und Genuss (miqqa), Liebe als friedliche Unterwerfung (istikana), Liebe als Intimität (oulf) und Liebe als Verführung (foutoun). Selbstverständlich gibt es Liebe als Verkehr (nikah) und Liebe als Erotikwahn und Zügellosigkeit (ibahi). Es gibt auch ein Wort für das Prestige, das eine Liebesbeziehung und die Gesellschaft von Frauen einem Mann verleihen (tashbeeb). Shawq ist mit dem griechischen Eros verglichen worden …
Das Wort jawa bezieht sich auf die abwechselnden Stimmungen von Hoffnung und Verzweiflung, die den Liebenden heimsuchen. Liebe, die uns geängstigt und verändert zurücklässt, ist wahl, während sabwa die Liebe zu jungen Mädchen und überhaupt jüngeren Menschen meint – das kommt von dem Wort sabi für den Jungen und sabia für das Mädchen. Einige Wörter haben doppelte Bedeutung, und eine verstärkt die andere: jounoun ist Verrücktheit und Liebe-als-Verrücktheit – daher der berühmte Majnoun (gesprochen Madschnuun) von Leila, bekannt auch als Qays. Lathaa ist der Vorgang, wenn eine Flamme hörbar hochklettert und ein Stück Rinde verzehrt, und es bedeutet auch glühende Liebe; halaak ist Auslöschung ebenso wie fatale Liebe.
In einem Kompendium von rund 7000 Büchern aus dem Bagdad des 10. Jahrhunderts namens Kitabu’l Fahrast, zusammengestellt von Abu Al-Faraj Ibn al-Nadeem, das einen Querschnitt der frühen arabo-islamischen Literatur bietet, beschäftigen sich nicht weniger als 100 mit der Liebe.
£ ∅ ξ
In einer Rezension vom Juni 2024 behandelt Max Bledstein den Debütroman von Hossein Asgari, einem in Adelaide lebenden Iraner. Das Buch heißt 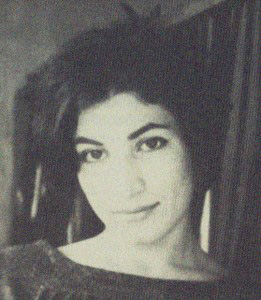 Only Sound Remains und ist eine Vater-Sohn-Geschichte. Der Erzähler ist Saeed, und zu Besuch kommt sein Vater Ismael, der in den 1950er Jahren in Teheran gelebt hat. Ich erwähne das, weil in dem Buch immer wieder Farogh Farrochzad vorkommt, die zauberschöne und verruchte persische Poetin, die so freizügig über die Liebe sprach, dass ihre Werke seit 1979 (als Khomeini an die Macht kam) immer wieder zensiert oder verboten wurden. Immer wieder spielt Asgari Gedichte oder Passagen von ihr ein, und das freut mich, da manipogo 2016 die junge Dichterin vorgestellt hatte, die bereits 1967, 32-jährig, starb.
Only Sound Remains und ist eine Vater-Sohn-Geschichte. Der Erzähler ist Saeed, und zu Besuch kommt sein Vater Ismael, der in den 1950er Jahren in Teheran gelebt hat. Ich erwähne das, weil in dem Buch immer wieder Farogh Farrochzad vorkommt, die zauberschöne und verruchte persische Poetin, die so freizügig über die Liebe sprach, dass ihre Werke seit 1979 (als Khomeini an die Macht kam) immer wieder zensiert oder verboten wurden. Immer wieder spielt Asgari Gedichte oder Passagen von ihr ein, und das freut mich, da manipogo 2016 die junge Dichterin vorgestellt hatte, die bereits 1967, 32-jährig, starb.
In dem Roman hat Ismael, der Vater, Farogh Farrochzad kennengelernt, die einmal schrieb:
In jener dunklen und stillen Abschließung
saß ich ängstlich an seiner Seite
Seine Lippen gossen Begehren auf meine Lippen
Ich entkam der Sorge eines verrückten Herzens.
Auch in Jasmin Darzniks Buch Song of a Captive Bird (2018) geht es um das Leben der Dichterin, die anscheinend durch ihr abenteuerliches Leben und ihre mutigen Verse zu einer Muse intellektueller Perser in der Diaspora wurde. Only Sound Remains macht Farrochzad zu einer Romanfigur und betont ihre fortdauernde Präsenz in der Kultur ihres Landes.
Verwandte Artikel:
Honigkuss – Frauen und Sexualität – Farogh Farrochzad
Das Bild oben rechts zeigt ein Beduinenpaar, fotografiert von der American Colony (Jerusalem) zwischen 1900 und 1920. Dank an die Library of Congress, Washington D. C.